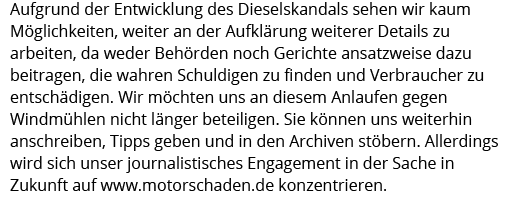Betroffene Dieselskandal-Opfer fragen sich oft nach dem Ablauf eines Verfahrens, in vielen Fällen gegen die Audi AG oder gegen Volkswagen. Der VW Passat 2,0 TDI aus dem Jahr 2016 ist ein gutes Beispiel, an dem ein solcher Verfahrensablauf ganz gut erklärt werden kann. Das Auto ist grundsätzlich betroffen, allerdimngs bestreitet Volkswagen das. Eine Abfrage auf der VW-Website durch die Eingabe der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN-Abfrage) ist nicht möglich.
Durch die Verwendung einer illegalen Einrichtung zur Abschaltung der Abgasnachbearbeitung kommt es zu einem Sachmangel, der auch durch eine Rückrufaktion nicht abgestellt werden kann, da die Maßnahmen eines Rückrufes andere Sachmängel hervorrufen, z. B. Reparatur-Anfälligkeit, höheren Verbrauch, Wertverlust, etc. Die Risiken und Folgen dieses Sachmangels muss nicht der Besitzer tragen, weshalb ein Rückgabeanspruch dem Hersteller gegenüber entsteht, da Händler nur zwei Jahre lang zur Verantwortung gezogen werden können: im Rahmen der sogenannten Gewährleistungspflicht auf Sachmängel. Danach sind Hersteller Anspruchsgegner.
Nun steht für unser 2016er Beispiel Passat 2,0 TDI (B8) sowohl die Betroffenheit als auch die rechtliche Grundlage fest. Dies gilt gleichermaßen für jeden Tiguan 2,0 TDI, jeden A4 2,0 TDI und jeden Touran 2,0 TDI und selbstverständlich für die Mutter aller Volksagen: den Golf 2,0 TDI., also den Golf 7
Wir kommen nun zum Punkt Verjährung: Ansprüche aus einem Sachmangel verjähren 24 Monate nach Kenntnis. Eine Solche kenntnis gibt es im EA288 Dieselskandal nicht, also ist Verjährung kein Thema.
Welche Verfahren werden gewonnen?
Experten der IG Dieselskandal wissen, dass es zu Richtersprüchen kommen kann, die den wirtschaftlichen Schaden des Klägers als gering einstufen, sollte das Fahrzeug exzessiv genutzt worden sein. Außerdem gibt es seltene Fälle, in denen Richter entscheiden, dass es viel mehr um den wirtschaftlichen Gewinn als einen erlittenen Schaden geht. Aus diesem Grund kommt es in erster Instanz vor dem Landgericht nur selten zur Abweisung einer Klage. VW Passat 2.0 TDI sind Dauerläufer, sogar Modelle mit über 200.000 Kilometern Kilometerleistung wurden bereits mit Erfolg zurückgegeben.
Kläger sollten deshalb auf jeden Fall in die zweite Instanz gehen. Im Rahmen einer Berufung hat VW in Folge der Beweislastumkehr nachzuweisen, dass weder Schaden entstanden ist noch Betrugsabsicht vorliegt. Genau dies fällt den Wolfsburgern allerdings schwer, insbesondere, weil in der Berufungsinstanz verwertbare Informationen verlangt werden und diese Daten vom Unternehmen unter Geheimhaltung gestellt wurden. Damit können wir die vielmals zitierte Aussage belegen: „VW vergleicht sich in der 2. Instanz“ – entweder VW vergleicht sich oder das Unternehmen tritt gar nicht erst an. Letzteres führt dann im Rahmen eines Versäumnisurteils zur Anerkennung des Klägeranspruchs.
Wie kann man sich so ein Urteil vorstellen?
Die Experten der IG Dieselskandal erklären, dass Kläger in der Regel mit einer Rückerstattung des im Kaufvertrag genannten Kaufpreises gegen die Rückgabe des Fahrzeugs rechnen können. Unter Umständen ist eine Nutzungsentschädigung fällig, in dessen Rahmen es zu einer entsprechenden Berechnung mit Abzug der Nutzung kommt. Die Gesamtsumme, die darauf entsteht, ist in jedem Fall sehr viel höher als der Gebrauchtwagenwert.
Und wer zahlt das alles?
In unserem Beispiel Passat 2,0 TDI ist die Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung Formsache: alle Kosten werden von der „RSV“ übernommen. Sollte sich die Versicherung weigern, gibt es juristische Mittel, zum Beispiel eine Deckungsschutzklage.
Oder besser sofort zu Myright?
Es gibt eine Menge Unternehmen, die durch „Stärke in der Gemeinschaft“ werben. Der größtmögliche Schadensersatzanspruch ohne Abzüge lässt sich nichtsdestotrotz ausschließlich in Form von Individualklagen realisieren. Die Kooperationsanwälte der IG Dieselskandal sehen genau hier den großen Vorteil gegenüber Sammelklagen-Anbietern, wie zum Beispiel Myright. Nach gewonnener Individualklage muss nämlich niemand seine Ansprüche teilen. Sollte keine Rechtsschutzversicherung vorliegen, so kann man das Verfahren auch selbst finanzieren. Auch das, so Experten der IG Dieselskandal, macht angesichts der hohen Erfolgsaussichten Sinn.
Wir warten lieber auf die Sammelklage?
Dass es im EA288-Dieselskandal zu einer Sammelklage kommt ist denkbar unwahrscheinlich. Daher sollte jetzt klagen, wer klagen will, möchte und kann - großartig verändern werden sich die Umstände nicht mehr.
Hier mehr auf Dieselskandal-Infos-Seite der IG Dieselskandal erfahren